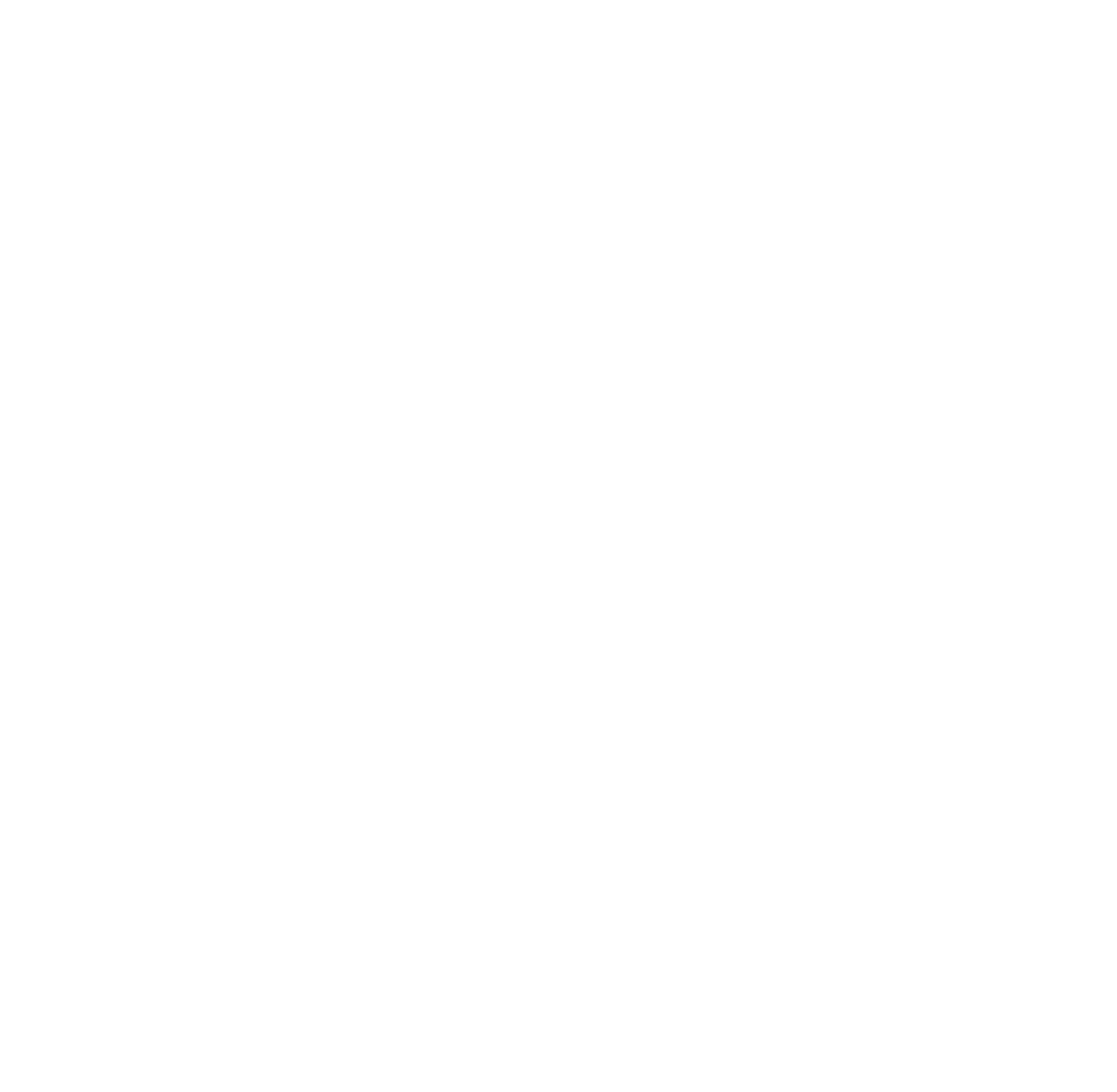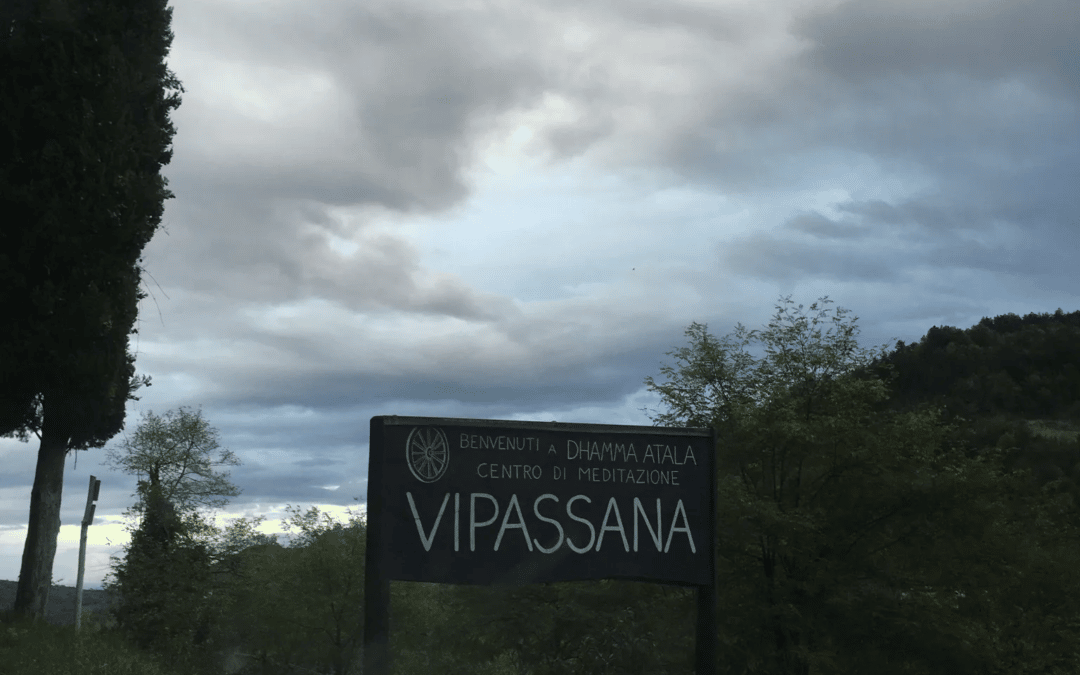Ich liege auf meiner Couch und denke nach. Am anderen Ende der Leitung ist Udo, mein Kollege aus der Coachingausbildung.
Dass ich mich in letzter Zeit irgendwie unwohl fühle, ist mir klar.
Körperlich muss ich mich schonen, das sagt zumindest mein Arzt. Sobald man den Begriff „Frühgeburtsrisiko“ hört, hält man die Füße still. Die Gedanken tun das nicht. Ganz im Gegenteil.
Also erzähle ich ihm, was momentan so los ist. Dass vieles herausfordernd ist, das meiste aber auch wunderschön. Aber ich mich trotzdem innerlich so unruhig fühle.
Ich denke das kennen viele. Man hat das Gefühl, dass etwas nicht passt. Kann aber nicht richtig lokalisieren, was es nun ist. Arbeit, Partner, Gesundheit, Eltern, Finanzen oder doch etwas anderes?
Irgendwie ist man unzufrieden, unruhig, genervt, sensibel und forscht unaufhörlich nach, was einem denn jetzt nicht passt.
Nach gewisser Zeit kommt der Satz „Ich muss mehr für mich tun!“ über meine Lippen. Ich halte kurz inne. Eigentlich ist Selbstliebe und Selbstfürsorge doch etwas Gutes. „Mehr für sich selbst tun“ klingt wichtig und richtig. Selbstliebe ist das A und O für ein glückliches Leben. Dabei ist z.B. die persönliche Morgenroutine ein großer Trend und auch ich bin ein großer Anhänger. Doch trotzdem löst dieser Satz in mir Schuldgefühle und eine gewisse Beklemmung sowie innerliche Anspannung aus. Das zeigt mir, dass ich meinen aktuellen Glaubenssatz gefunden habe.
Was ist eigentlich ein Glaubenssatz? Im Grund kann jeder einzelne Gedanke ein Glaubenssatz sein. Dass es einer ist, merkt man am einfachsten daran, dass uns der Gedanke nicht in Freude und ein Gefühl inneren Friedens versetzt, sondern unruhig und unzufrieden werden lässt. Manchmal sogar traurig oder verletzt bis hin zu einer inneren Starre.
Es können Gedanken sein wie: Ich sollte mehr arbeiten! Ich sollte weniger arbeiten! Ich sollte mehr Sport machen! Ich sollte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen! Ich sollte abnehmen! Ich sollte mehr essen! Jeder Gedanke kann ein Glaubenssatz sein. Ausschlaggebend ist die individuelle Bedeutung für die jeweilige Person.
Oftmals stammen sie aus der Kindheit und sind mit Erfahrungen und Erwartungen aus der Kindheit verbunden. Unsere Kindheit prägt uns, aber sie muss uns nicht bestimmen.
Zurück zu meinem Glaubenssatz: Ich muss mehr für mich tun.
Vor zwei Monaten bin ich zu meinem Freund auf einen wunderschönen Bio-Bauernhof gezogen. Mit mir meine beiden Pferdchen, die das Leben hier so sehr genießen wie ich.
Mein Tagesablauf hätte sich dadurch nicht mehr ändern können.
Von einer schicken Stadtwohnung, in der ich morgens einer festen Morgenroutine gefolgt bin, die von Meditation im Stillen, Yoga oder Joggen, Journalling bei einer Tasse Tee, dem Aroma-Öl-Vernebler im Hintergrund und einem komplett selbstbestimmtem Ablauf geprägt war, hin zu einem schnellen Glas Wasser in der Früh bevor es in die Gummistiefel geht und dann ab in den Stall, wo zwei Pferde mich hungrig anwiehern, ein Lämmchen lautstark (ihr macht euch keine Vorstellung wie laut das sein kann!) nach der Flasche verlangt, ein Huhn mir gackernd zwischen den Beinen herumläuft, die Katzen gefüttert werden wollen und der Hund nicht Ruhe gibt, bevor er nicht seine angemessene Guten-Morgen-Kraulerei bekommt. Und das ist nur der frühe Morgen.
Klar habe ich mir das selbst ausgesucht und ich liebe es. Trotzdem muss mein Ego das erst mal verkraften. Dass es nicht mehr nur um mich selbst geht. Dass mein Tagesablauf nicht zu 100% von mir selbst bestimmt werden kann.
So viel zum Hintergrund und zurück zum Gespräch mit Udo. Seit unserer Coaching Ausbildung telefonieren wir regelmäßig miteinander, um uns gegenseitig durch den „The Work of Byron Katie“ Coaching Prozess zu begleiten. Auch ein Coach braucht einen Coach und oft ist das bei mir Udo, der in seiner pragmatischen und seelenruhigen Art den Raum perfekt hält.
So auch dieses Mal. Wie immer beginnen wir mit einer kleinen Meditation. Einfach nur dem Atem folgen. Zum ersten Mal entspanne ich mich merklich und merke wieder einmal, wie gut und heilsam einfach nur Stille und Nichtstun ist. Durch diese anfängliche Ruhe kann ich mich fallen lassen und komme durch „The Work“ und die Umkehr meines anfänglichen Glaubenssatzes zu folgenden Einsichten:
1. Ich muss nicht mehr für mich tun.
Wer sagt mir denn, dass ich mehr für mich machen muss? Eigentlich nur ich selbst bzw. mein Ego, das Angst vor Veränderungen hat und am Gewohnten festhalten will.
Vor allem kommt es doch darauf an, WIE man etwas tut bzw. nicht tut.
Denn ich kann zwei Stunden „meditieren“ und dabei schwirren mir aber die To Dos der Woche durch den Kopf oder ich kann den Tag über kleine Momente nutzen und dabei ganz bewusst sein. Wenn ich zum Beispiel dem Lämmchen die Flasche gebe und es währenddessen kraule, kann ich bewusst das flauschige Fell oder die Schmatzgeräusche (vom Lamm, nicht von mir) wahrnehmen. Wenn ich aus dem Küchenfenster die Schafe auf der Weide beobachte, dann kann ich für eine Minute meinem Atem lauschen. Diese bewussten Momente sind zu meiner neuen Meditation geworden. Aber anfangs war mir das nicht bewusst. Es stresste mich den ganzen Tag, wenn ich aufstand, ohne zuvor meditiert zu haben.
2. Ich darf mehr für andere tun.
Durch den kürzlichen Umzug wurde mein Leben ziemlich umgekrempelt. Von völliger Selbstbestimmung und Entscheidungsfreiheit wann ich was tue, lebe ich nun in einem Gefüge aus verschiedenen Individuen, Mensch als auch Tier. Deshalb erschien mir das Füttern und Verpflegen der Tiere, das Kochen für mehr als nur zwei Personen, der Haushalt in einem großen Haus zwar als schön und irgendwie auch erfüllend, aber ich sah es nicht als etwas an, das ich für mich tat. Sondern für andere. Je mehr ich für andere tat, umso schlechter fühlte ich mich, weil ich mich nicht um mich und meine eigenen Aufgaben kümmerte. Dabei verstand ich nicht, dass ich auch durch und mit anderen etwas für mich tun kann. Dadurch, dass ich meine Zeit bewusst gebe und schenke (und nicht, weil ich denke ich müsste es tun), handle ich selbstbestimmt und habe für mein Tun die volle Verantwortung. Dadurch tue ich es automatisch für mich.
Im Grunde ist es auch ein Zeichen der Zeit. Meiner sogenannten „Umstellungszeit“. Denn ein Baby wird die eigenen Prioritäten sicherlich verschieben. Und wenn ich mir dann jedes Mal beim Stillen denke: „So liebes Babylein, jetzt hab ich etwas für dich getan, jetzt lass Mama auch mal was für sich tun“, dann wird das wohl nur so semi gut funktionieren.
3. Ich darf mehr für mich tun.
Im Vergleich zum Ausgangsglaubenssatz ist hier nur das Wörtchen ‚muss‘ in ein ‚darf‘ geändert. Diese kleine Veränderung nimmt aber bereits unglaublich viel Spannung und Druck aus dem Satz. Wenn mir der Sinn danach steht, dann kann ich etwas für mich tun. Es steht mir zu, aber es obliegt meiner eigenen Entscheidung und meiner Laune, nicht meinem strengen Ego.
Gerade während der Schwangerschaft hat jeder einen guten Rat parat. Natürlich immer gut gemeint, aber am öftesten höre ich folgendes:
„Du musst jetzt viel schlafen, später wird das nichts mehr!“ So als ob man einen zahnlosen und schreienden Terrorist zur Welt bringen würde, der einen bis er 18 ist nie wieder schlafen lässt.
„Ihr müsst jetzt nochmal zusammen in den Urlaub fahren. Nach der Geburt ist das für immer vorbei!“. Mit einem Landwirt als Freund ist Urlaub ohnehin spärlich gesät, aber was ist denn mit Urlaub mit Kind? Ist das denn so schrecklich?
Wenn ich dann noch meinen Instagram Feed durchscrolle und meine schwangeren Freundinnen und Bekannten sehe, wie sie Berge erklimmen, in tolle Cafés gehen, in Barcelona Umstandsmode shoppen und sich halt #metime gönnen, dann stellt sich bei mir auch mal ganz schnell #fomo (= fear of missing out) ein.
Da fühlen sich gutgemeinte Ratschläge schnell an wie eine strenge To Do Liste, die es zu befolgen gilt, weil die Glückseligkeit sich dann niemals wieder einstellt.
Und etwas „für sich selbst tun“ verliert das friedvolle und leichte Gefühl.
4. Ich muss noch weniger für mich tun.
Wenn ich Revue passieren lasse, wie viel ich an einem Tag tue, dann ist das schon eine Menge. Ich bin mir sicher, dass es jedem so geht: Wenn man sich nur die Zeit nimmt, um bewusst wahrzunehmen, wie viele tausend Kleinigkeiten man eigentlich den Tag über erledigt.
Anstatt also immer noch mehr zu tun, ist es durchaus angebraucht, auch einfach mal wenig oder gar nichts zu tun. Und das bewusst und ohne Reue!
Z.B. einfach nur in Stille dasitzen, ein paar Minuten seinem Atem lauschen, sich auf den Küchenstuhl setzen und den Vögeln beim Zwitschern zuhören, ein kleines Mittagsschläfchen und vieles mehr. Manchmal tendiert man auch dazu, sich eine regelrechte „Entspannungs-Agenda“ zusammenzustellen. Ich kenne das sehr gut und neige auch selbst manchmal dazu. Erst meditieren, dann gehe ich ins Yoga, dann lese ich im Buch Seite 45 bis 68 und dann gehe ich in die Sauna. Kann zwar entspannend sein, wahre Entspannung liegt aber meistens im bewussten Nichtstun.
Als wir am Ende unserer Session angekommen sind und ich in die Nachwirkungen dieser Erkenntnisse hineinspüre, fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Ich atme ruhiger und tiefer, ich fühle mich freier und leichter und bin absolut beschwingt. Ich habe zum ersten Mal seit langem auch wieder Lust, etwas für mich zu tun und empfinde es nicht als Pflicht.
Wie so oft werde ich mir bewusst, wie heilsam „The Work“ für mich persönlich ist. Es hilft mir immer wieder aufs Neue, den belastenden Glaubenssatz zu finden, die Problematik dahinter zu verstehen und ihn auch gleich aufzulösen.
Meine Herausforderungen derzeit sind damit zweierlei:
Erstens wieder eine neue „Routine“ für mich zu etablieren und zweitens den Wandel annehmen und daraus lernen, dass die einzige Konstante im Leben die Veränderung ist. Und sich somit auch Routinen ändern dürfen…