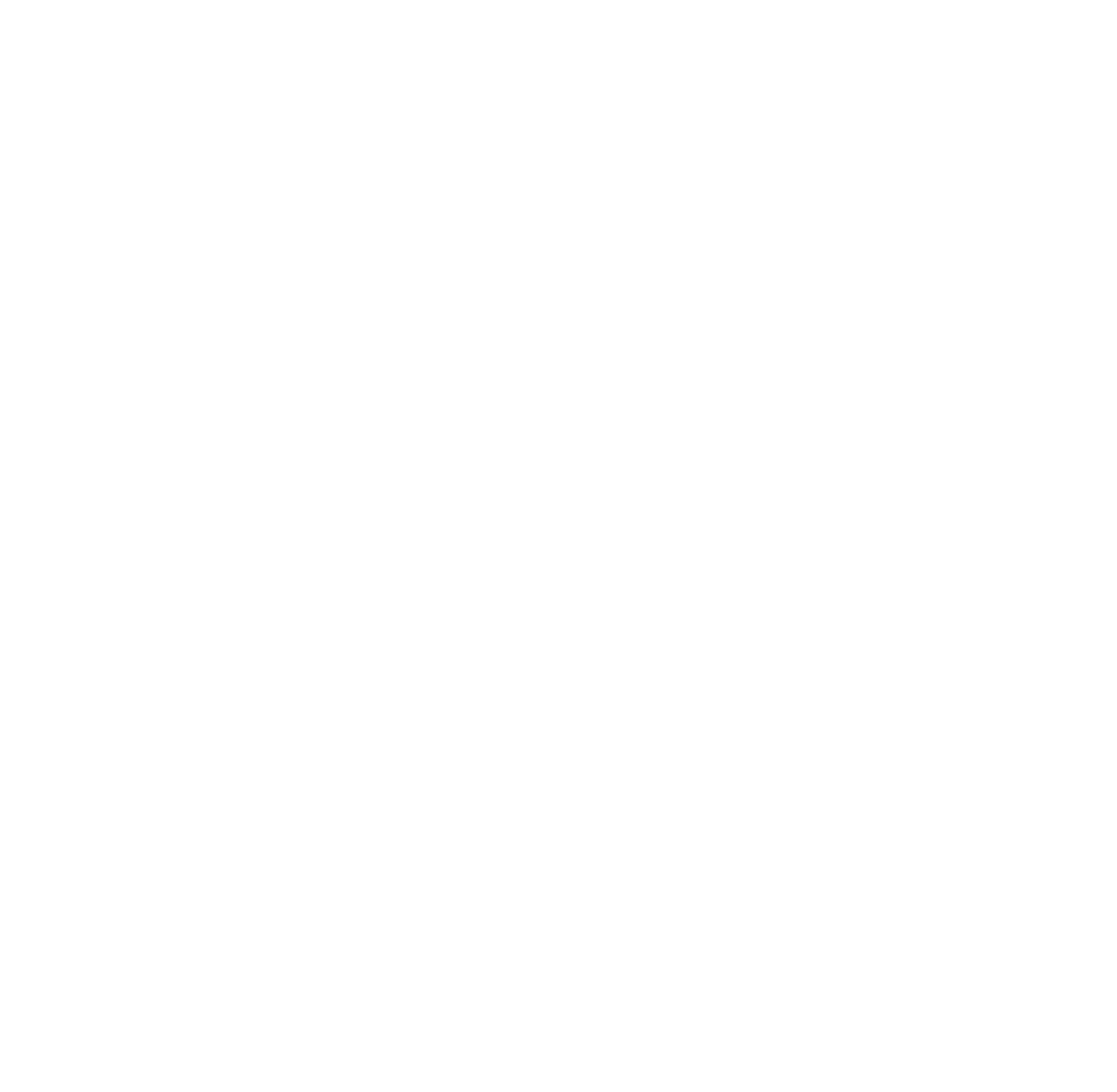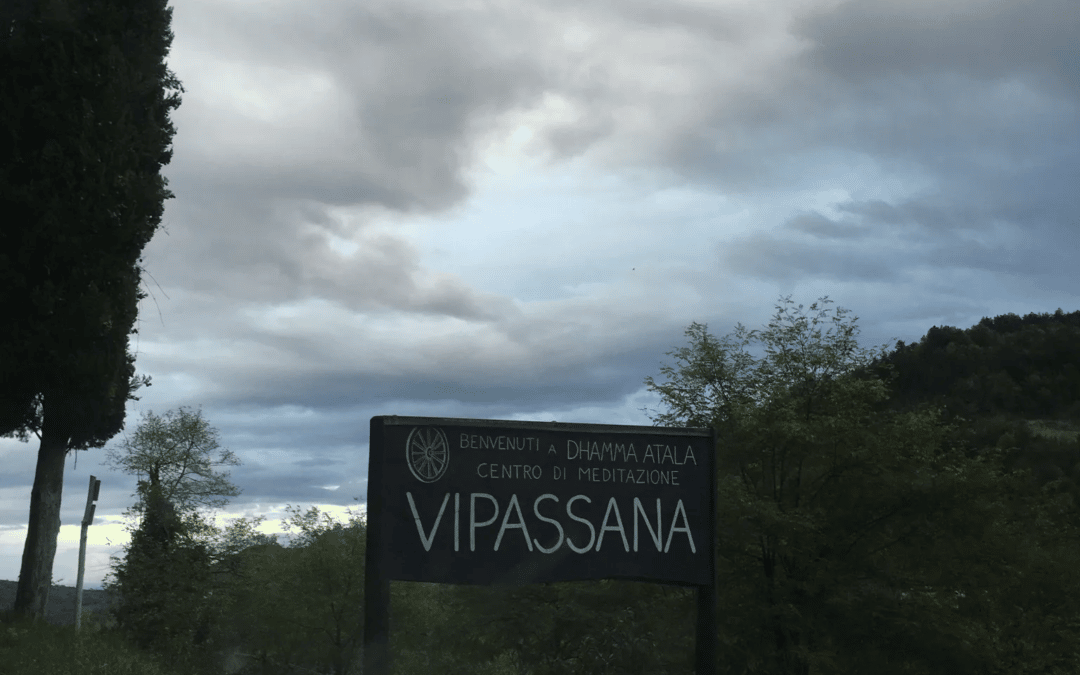Disclaimer: Dieser Artikel ist nicht die Fortsetzung der Romanserie von E.L. James. Dennoch wird der aufmerksame Leser auch etwas Zuckerbrot und vor allem Peitsche darin finden 🙂
Besonderer Dank gebührt im Übrigen Matthias Middendorf für seine Inspiration zu Erbsenmus…
Jeder kennt die Gebrüder Grimm und ihre Märchen. Darunter sicherlich Schneewittchen. Die, ehe sie mit dem Prinzen ihrer Träume dem Sonnenuntergang entgegen ritt, von einer bösen Zauberin (a.k.a. Stiefmutter) eine Frucht überreicht bekam, in die sie hineinbiss und die sie in einen tiefen todesgleichen Schlaf fallen ließ.Würde dieses Märchen heute spielen, so würde unser Schneewittchen wohl in eine thailändische Flugmango beissen (zuvor postet sie aber noch ein Mango-Selfie auf Instagram). Klingt komisch, oder? Ja, finde ich auch. Bleiben wir lieber beim rotbackigen Apfel. Bei einem weiteren Märchen von Hans Christian Andersen schlief eine Prinzessin auf einem grünen und harten Etwas, das sie kaum zur Ruhe kommen ließ, wodurch aber (diesmal veranlasst durch die Schwiegermutter in spe) ihre Feinfühligkeit und Prinzessinnen-Echtheit getestet werden sollte. Wie hieß dieses Märchen gleich nochmal? Die Prinzessin auf der Avocado! Nein, wieder falsch. Es war die Erbse.
Warum sind wir aber alle so wild auf Obst und Gemüse jenseits der sieben Berge? Warum kommt uns das Regionale langweilig vor? Warum meinen wir, ohne exotische „Superfoods“ niemals gesund und schön sein zu können? Denn sie sind doch so gesund, oder etwa nicht?
Schauen wir uns die Avocado an, so bekommt sie problemlos das Siegel für Gesundheitsförderlichkeit aufgeklebt. Doch ist alles was gesund ist, automatisch auch gut?
Wäre die Avocado ein Mensch, so wäre sie ein übermäßig durstiger, um nicht zu sagen ein Schluckspecht. 1 Kilogramm Avocados (das sind circa 2,5 Stück) brauchen nämlich schlappe 1.000 Liter Wasser, bis sie geerntet werden können. Zum Vergleich: Ein Kilogramm Tomaten braucht durchschnittlich 150 Liter Wasser, 1 Kilogramm Salat etwa 130 Liter.
Nun schwebt die Avocado nach der Ernte aber nicht magischerweise auf unseren Teller, sondern muss erst noch um die halbe Welt reisen. Auf dem Landweg 1.000 Kilometer, dann noch eine Schiffsüberfahrt von gut 25 Tagen. Während dieser gesamten Zeit chillt die Avocado bei angenehm frischen 6 Grad in einem strombetriebenen Container. Da es sich ohne Polster auch nicht so gemütlich reist, wird sie auch noch schön ausgiebig eingepackt.
Am Siegel für gute Energiebilanz schrammt unsere Avocado also nicht nur haarscharf vorbei, sondern rollt zielsicher in die komplett entgegengesetzte Richtung.
Ökologisch? Nachhaltig? Fair? Ressourcenschonend? Würde man sie wieder mit einem Menschen vergleichen, so wäre sie wohl, um meine beste Freundin Evelyn zu zitieren, ein „social Underperformer“. Sozusagen der Donald Trump unter den Obst- und Gemüsesorten.
Vor zwei Wochen war der deutsche „Earth Overshoot Day“. Das heisst, dass wir bis zu diesem Tag unsere kompletten Ressourcen aufgebraucht haben, die uns innerhalb Deutschlands zur Verfügung stünden. Von nun an leben wir quasi auf Pump. Und auf Kosten anderer, insbesondere auf Kosten der Länder des globalen Südens. Ein sehr ernüchternder 2. Mai.
„Globaler Süden – Globaler Handel“ war auch das Thema des zweiten Wochenendes der Slow Food Youth Akademie. Warum gibt es überhaupt globalen Handel? Einer der Gründe ist der der Verfügbarkeit. Denn eine Ananas wächst nun mal leider nicht in München. Ganze 10% des globalen Handels beinhalten Agrarerzeugnisse. Schaut man sich die Struktur der Importe genauer an, so fällt auf, dass knapp 70% der Agrarerzeugnisse vor allem Futtermittel sind. Das heisst: Futter, für die Tiere, die wir essen. Um unseren Hunger zu stillen, „importiert“ Deutschland pro Jahr 5,5 Millionen Hektar Ackerland, EU-weit kommen wir auf 35 Millionen Hektar. Zum Vergleich: Ein Fußballfeld misst 0,7 Hektar.
Was bedeutet dies nun für uns? Gar nichts mehr importieren? Eine Alternative, um diese Ungerechtigkeit zu bekämpfen, wäre natürlich eine radikale Regionalisierung. Was heisst: Es kommt nur auf den Tisch, was eben gerade bei uns in der Region Saison hat.
Dass es keineswegs so radikal sein muss und wir nicht nur selbst geernteten Brennessel Tee trinken müssen, beweist ein deutsches Unternehmen namens Coffee Circle. Ihre Mission lautet „United to improve lives by delivering outstanding coffee“. So simpel wie genial. Einfachheit ist eben die höchste Form der Vollendung, das wusste schon Leonardo da Vinci. Coffee Circle bietet den Kaffeebauern Hilfe zur Selbsthilfe. Und zwar indem sie die Kaffeebohnen nach qualitativen, sozialen und ökologischen Kriterien direkt bei den Produzenten einkaufen. Das Ziel ist es, dass die Produzenten mehr am Kaffee verdienen. Deshalb sind sie auch bereit, vom Weltmarkt unabhängige und damit höhere Preise zu zahlen. Beim Kauf eines jeden Kaffees gehen 1 Euro pro Kilogramm Kaffee als Spende an soziale Projekte. So zum Beispiel für die Versorgung von knapp 20.000 Menschen in der äthiopischen Kaffeeregion Limo mit sauberem Trinkwasser. Insgesamt wurden schon 1 Million Euro gespendet und das Leben von über 130.000 Menschen positiv beeinflusst. Mehr zu Coffee Circle findet man hier.
Wenn also jeder auf fair und nachhaltig produzierte Importprodukte zurückgreift, wäre dann der Hunger in der Welt beseitigt?
Leider nein. Um es in den Worten von Martin Caparrós auszudrücken: „Der Hunger wird nicht nur durch Mangel verursacht. Die 800 Millionen Menschen hungern nicht, weil wir unfähig wären, genügend Nahrungsmittel herzustellen. Im Gegenteil: Wir produzieren mehr, als wir tatsächlich benötigen. Sie werden vielmehr von den ungefähr zwei Milliarden Menschen, von uns Satten in den reichen Ländern, verbraucht. Hunger beruht also nicht auf Mangel, sondern auf der schlechten Verteilung unseres Reichtums an Nahrungsmitteln.“ Das ganze und absolut lesenswerte Interview gibt es hier.
Würde jeder so essen wie wir (in den USA war der Earth Overshoot Day dieses Jahr sogar schon am 14. März), dann würde das System in zwei Jahren kollabieren. Wir zählen zur reichen Minderheit. Martin Caparrós verdeutlicht dies mit einem Beispiel: „Um ein Kilogramm Rindfleisch zu erzeugen, werden zehn Kilogramm Getreide benötigt. Wenn jemand zehn Kilo Getreide geerntet hat, dann besitzt er zwei Optionen: Er kann zehn Personen jeweils ein Kilo verkaufen oder zehn Kilo an einen Fleischfabrikanten, damit dieser ein Kilo Fleisch für einen wohlhabenden Käufer herstellt und dabei sehr viel mehr verdient.“
Es reicht also für alle – aber nur, wenn jeder 100% Verantwortung für das eigene Handeln übernimmt.
Das Gefühl, das bei mir nach den Vortragen zurückblieb, war ein sehr gemischtes: Ich habe noch unendlich viel zu lernen. So viel, das ich noch nicht weiß, aber wissen möchte, um mich so zu ernähren, dass es meiner persönlichen Mission entspricht. Entmutigt mich das? Nein, absolut nicht.
Und da wir bereits in der Schule gelernt haben, dass anklagen und sich beschweren weder zielführend ist, noch irgendetwas besser macht, sind echte Alternativen zu Avocado & Co. gefragt. Les voilà:
Um ehrlich zu sein ist die Erbse ja nicht gerade für ihre Coolness bekannt. Die meisten verbinden sie mit dem Glas im Supermarktregal, in dem blassgrüne und milchige Kugeln nicht gerade schreien: „Iss mich! Ich bin ein Superfood und mache dich schön und sexy!“
Aber da ich schon immer mehr auf die inneren Werte stand, habe ich es einfach mal ausprobiert.
Fazit: I love it!
Natürlich dauert die Zubereitung eine gewisse Zeit. Aber in Zeiten, in denen Entschleunigung und Achtsamkeit immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist das Erbsen pulen fast schon meditativ. Ich habe also die frischen Erbsen (haben gerade Saison, eine schöne Saisonübersicht für Obst und Gemüse aus heimischen Gefilden gibt es hier) aus ihrer schützenden Hülle befreit und dann kurz in Olivenöl angeschwitzt. Man könnte sie vermutlich auch einfach kochen. Anschließend mit der Gabel zerquetscht, etwas frischen Zitronensaft dazu, Salz, Pfeffer und rauf aufs Vollkornbrot. Das Resultat könnt ihr bei den Fotos bestaunen.
Nicht nur geschmacklich, auch optisch wunderschön. Dieses leuchtende Grün sucht seinesgleichen. Wer nicht so viel improvisieren möchte, der findet ein bombensicheres Rezept bei essen + trinken. Da mich das Erbsenfieber daraufhin gepackt hatte, gab es gleich noch etwas mit Erbsen. Und zwar Pasta. Ein grandioses Gericht mit Zitrone, Minze und Erbsen gibt es hier. Zusätzlicher Bonus: Ich konnte etwas von der Minze verwenden, die auf meinem Balkon wächst, als gelte es einen Preis in Wildwuchs zu gewinnen.
Ein weiteres Superfood ist die Acai-Beere, die zermust und mit Granola aufgehübscht als die Offenbarung unter den Früchten gilt. Eine regionale Alternative ist die wunderbare Blaubeere. Diese kann genauso gemixt und nach Herzenslust dekoriert werden. Muss aber dafür nicht um die halbe Welt reisen.
Ohnehin ist es ja so, dass jedes Obst und Gemüse grundsätzlich ein „Superfood“ ist. Denn eine positive Wirkung auf den menschlichen Körper gibt es davon immer. Auch die Erbse macht gesund und glücklich. Und ein gutes Gewissen.
Mein persönliches Fazit ist somit:
Beim gesunden Essen geht es nicht nur darum, gesunde „Superfoods“ zu essen. Essen ist eine Frage von Politik, der Gesundheit, der Produktion und Herstellung und vielem mehr.
Um das ganze Bild zu verstehen, braucht man jede Menge Zeit und eine Menge Verstand. Muss man also ein ausgewiesener Experte auf all den vorgenannten Gebieten sein, um sich auf eine verantwortungsvolle Art und Weise ernähren zu können? Nein, absolut nicht. Aber es wäre hilfreich, wenn wir uns alle öfter unseres gesunden Menschenverstands bedienen würden. Denn dass ich mir eine Avocado nicht selber im Garten ziehen kann, sollte jeder wissen. Und dass ich sie noch nicht in Italien gesehen habe, sollte mir auch klar machen, dass sie wohl einen relativ weiten Weg hinter sich hat, wenn sie im Supermarktregal landet.
Deshalb wünsche ich mir, dass wir nicht nur darüber nachdenken, was wir uns gerade in den Mund schieben, sondern auch wo es herkommt, wie es produziert und geerntet wurde und ob ich das jetzt auch unbedingt haben muss. Oder ob es a) weniger, b) etwas anderes oder c) manchmal auch einfach gar nichts sein kann. Verzicht und Rücksicht auf unsere Umwelt kann durchaus etwas Erhabenes sein. Schon die Moral in Hans Christian Andersens Märchen „Die Prinzessin auf der Erbse“ war, dass wahrer Adel in Feinfühligkeit und nicht in Reichtum steckt.
Ich will mit meinem Artikel niemanden durch einen erhobenen Zeigefinger bekehren oder suggerieren, dass ich den heiligen Gral in Bezug auf Essen entdeckt habe. Werde ich nie wieder in meinem Leben eine Avocado essen? Eher unwahrscheinlich. Aber eines weiß ich sicher: Wenn ich mal wieder eine esse, dann werde ich mir bewusst machen, dass der Verzehr ebendieser nicht nur ein Luxus, sondern ein Privileg ist, das ich gefälligst zu schätzen habe. Dem ich meine ganze Aufmerksamkeit schenke. Und dem ich mich darüber hinaus mit ganzem Herzen widme.
Denn für mich geht es bei Essen vor allem um eines: Liebe.
Liebe für die Menschen, die das Produkt herstellen, Liebe für die Tiere, die ich liebe, aber nicht esse und vor allem Liebe für mich selbst, indem ich mich bewusst ernähre.
Deshalb: Spread the love and vote with your fork.